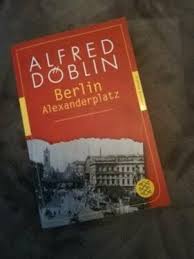
Die expressionistischen Dichter Alfred Döblin
(„Berlin Alexanderplatz“) und Gottfried Benn („Morgue-Zyklus“) gelten heute als
bedeutende Vertreter der literarischen Moderne. Sie kämpften als Ärzte und Dichter gegen die Vanitas.
Nach Sigmund Freud (1856–1939) ist Vergänglichkeit keineswegs mit der Entwer-
tung des Schönen verbunden, sondern im Gegenteil als „Wertsteigerung“ aufzufassen. Bei der Betrachtung der bildendenden Kunst und Literaturwird das Fazit seiner Studie über Das Unbehagen in der Kultur durch einen Vers aus Friedrich Schillers Ballade
Der Taucher gemildert:
Es freue sich, wer da atmet im rosigen Licht.
Auf diese Ballade berief sich auch Alfred Döblin (1878–1957): In beson-
ders kritischen Situationen seines Lebens habe er sich daran erinnert, weil
dem Bericht des Tauchers über die Gefahr, in einen Strudel zu geraten, ein
hoffnungsvoller Vers auf dem Fuß folge:
Doch es war mir zum Heil, es riss mich nach oben.
Döblin gehörte zu den wenigen Arztdichtern der Moderne, die offenbar
so gottesfürchtig wie die Barocklyriker waren und sich anscheinend auch vor keinem Menschen fürchteten. Er bekannte freilich, dass es ihm unter
seinem eigenen psychotherapeutischem Blick manchmal „ganz bänglich“ geworden sei; man könne eben keine „wirkliche Autobiographie“ schreiben, also nicht zugleich derjenige, „der in den Spiegel schaue, und der Spiegel“ sein.
Die nur in der Phantasie existierenden Vorgänge, von denen nur ein Pseudo-loge fest überzeugt ist, entsprechen den Konfabulationen der Alkoholkranken, die
Alfred Döblin in seiner Dissertation über das Korsakow-Syndrom beschrieb. In diesen
Täuschungssituationen kann Klarheit nur durch große Umsicht, Auf- merksamkeit und geschärfte Wahrnehmung gewonnen werden.
Nach Döblin ist eine wichtige Voraussetzung der Dichtkunst ein „übernormal scharfes Sehen“. Denn ein Schriftsteller wie er be-trachtet die Dinge nicht einäugig aus einem Winkel, sondern
mehrperspektivisch und stereoskopisch; er kann daher Gegen-
stände dreidimensional beschreiben. Die Lektüre seiner Texte
vermittelt – wie bei einem Blick aus dem Fenster bei einer Fahrt
durch eine Landschaft – den Eindruck, dass die räumlich wahr-
nehmbaren Dinge vor einem Hintergrund stehen: ein Baum vor
dem Fluss, eine Burg auf dem Berg am Horizont. Je weiter ent-
fernt, desto bläulicher erscheinen die kulissenartigen Hügel. Der
Abstand eines Gegenstandes von seinem Hintergrund wird um-
so deutlicher sein, je schärfer das Sehen und je genauer die Re- zeption des räumlichen Eindrucks ist.
• Es entsteht Dreidimensionalität, wenn zum Beispiel in der Vorstellung
anschauliche Abbilder von Lebewesen erscheinen: das Wild im Wald.
Nach einem Augenblick des Stillstands ist zu er warten, dass die Tiere zwischen den Bäumen hervortreten. Diese Bewegung fesselt die Wahrnehmung.
Döblin hatte auch die originelle Hypothese aufgestellt: „Das gefährlichste
Organ des Menschen ist der Kopf“. Schon während des Medizinstudi-
ums schrieb er eine satirische Kopf-ab-Geschichte:
Sein Arm hob sich, das Stöckchen sauste, wupp, flog der Kopf ab.
Der Kopf überstürzte sich in der Luft, verschwand im Gras. ((Die Ermordung einer Butterblume und andere Erzählungen. München 1913).
Als Döblin den berühmten Autor des Stücks Reigen (1921) in einer zuge-
spitzten Theaterkritik förmlich aufspießte und „Arthur der Zerschnitzler“ nannte,
bezog er sich auf die Dichtkunst des Wiener Kollegen, den er aber
als Urheber der von ihm selbst angewandten Methode des inneren Mono-logs bewunderte. Döblin folgte zwar durchaus den von Schnitzler im Wiener
Milieu der Jahrhundertwende aufgenommenen Spuren des vorbewussten Denkens;
er favorisierte jedoch den breiten Bewusstseinsstrom, der später
vor allem seinen Berliner Großstadtroman durchflutete. Mit der Umdeu-
tung des Namens kritisierte er Schnitzlers dramatische und narrative
Technik insofern, als diese nach seiner Auffassung eine Trennung von
Erotik und Sexualität bewirkt habe; er bezog sich also nicht etwa auf dessen
pathologisch-anatomische Fertigkeiten, vielmehr schätzten beide, der
Berliner wie der Wiener Dichter, nicht nur die Zergliederung der Um-gangssprache zugunsten des inneren Monologs, sondern auch den Nutzen
autoptischer Studien zur Erforschung der Körperfunktionen:
Das psycho logische wie das sezierende Handwerk der schreibenden –
Nervenärzte zeigte sich in der Erzählkunst, in der Sprache und vor allem in der Erforschung sprachlicher Leistungen.
Dies fand einen besonderen Ausdruck darin, dass der Wiener Neuro-
loge Sigmund Freud – kurz bevor er die Psychoanalyse erfand – eine große Zahl
von Hirnsektionen vorgenommen hatte, um einen neuen Zugang zu
den Sprachregionen und Sprachfunktionen zu eröffnen. Anhand seiner
kritischen Studie über Aphasien (1891) war es möglich, die funktionel- len Bilder kortikaler Sprachareale zu interpretieren und eine darauf grün-
dende, von neurobiologischer Seite verfochtene Hypothese zu prüfen:
Nicht nur die Sprache und Sensomotorik, Wahrnehmungen und Bewe-
gungen, sondern auch die seelischen Regungen sind an Hirnfunktionen gebunden.
Nun war kaum mehr außer Acht zu lassen, dass nicht nur das
Gehirn, vor allem die Sprach- und Wahrnehmungsareale, zunehmend
wichtige Forschungsobjekte – und darüber hinaus Döblins Biberkopf
ebenso wie Schillers Schädel interessante Untersuchungsgegenstände der
Literaturwissenschaft – geworden waren, sondern es wurde auch bedacht, dass zur Wissenschaft vom Menschen der gesamte Körper gehört.
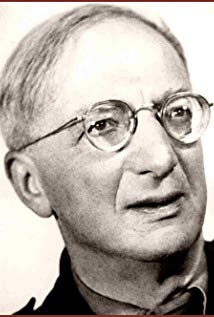
Alfred Döblin